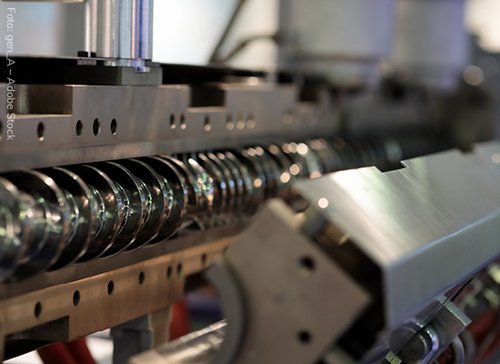Newsroom
„The Last Meal“: Karlsruher American Diner führt Geschäftsbetrieb auch im vorläufigen Insolvenzverfahren weiter
30. Juni 2025
Pressemitteilung, Verfahren
Finanzielle Schwierigkeiten: Sanierung? Ja, aber mit Plan!
24. Juni 2025
Blog, Insolvenzrecht, Restrukturierung und Sanierung, Wirtschaftsrecht
Stichtag 1. Juli: Wie Unternehmen finanzielle Risiken durch die Erhöhung der Pfändungsfreigrenzen vermeiden
24. Juni 2025
Blog, Insolvenzrecht, Restrukturierung und Sanierung, Wirtschaftsrecht
Die Magnolie erblüht
23. Juni 2025
Blog, Insolvenzrecht, Restrukturierung und Sanierung, Wirtschaftsrecht
Herzog: Sanierungsoptionen für traditionsreichen Spezialisten für Vorzelte und Outdoor-Ausrüstung werden geprüft
17. Juni 2025
Pressemitteilung, Verfahren
Extrudex: Übernahmelösung für den Spezialisten für Maschinen und Komplettsysteme in der Kunststoff-Extrusion
17. Juni 2025
Pressemitteilung, Verfahren
Stotz Feinmesstechnik setzt seine strategische Neuausrichtung in eigener Regie fort
10. Juni 2025
Pressemitteilung, Verfahren
ZIEGLER: Insolvenzverwalter verkauft Eurosand an Investorengruppe
10. Juni 2025
Pressemitteilung, Verfahren
Auch interessant
Hier finden Sie Informationen zu Sonderthemen
Gesundheitswesen Restrukturierung und Sanierung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen
Deutschland / Frankreich Rechts- und Steuerberatung für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen
Managerhaftung Vermeidung von Haftungsansprüchen, Verteidigung und Durchsetzung
Beraterhaftung Risikobegrenzung in der Krise des begleiteten Unternehmens
Insolvenzanfechtung Wenn in der Geschäftsbeziehung plötzlich Zahlungsrückstände entstehen
Projektsteuerung Sanierungselemente entwickeln und in Einklang bringen
Informiert bleiben
Zum Newsletter anmelden
Sie möchten regelmäßig Informationen über interessante rechtliche und steuerliche Entwicklungen erhalten?
Kontakt
Perspektiven vermitteln
Wir stehen Ihnen als erstklassige Krisenberatung gerne zur Verfügung! In unserem Newsroom erfahren Sie in den unterschiedlichen Rubriken mehr über die geeigneten Instrumente und etablierten Prozesse, mit denen wir passende Maßnahmen erarbeiten, um den langfristigen Erfolg von Unternehmen zu sichern. Informieren Sie sich!
Susanne Grefkes
Leiterin Unternehmenskommunikation