IDW S 16: Ein Schlaglicht auf Krisenfrüherkennung und Krisenmanagement
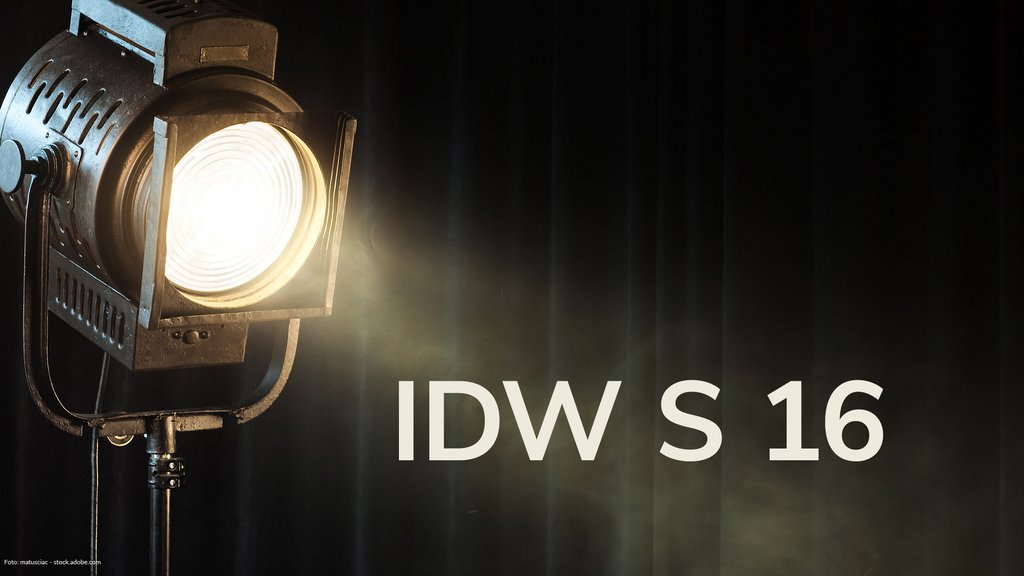
Unternehmen sehen sich einer Vielzahl an wirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber. Fakt ist: Kein Unternehmen ist davor gefeit, in eine wirtschaftliche Schieflage zu geraten. Guido Koch von Schultze & Braun ordnet den neuen IDW S 16 ein, der ein Schlaglicht auf die besondere Bedeutung von Krisenfrüherkennung und Krisenmanagement wirft.
Inhaltsverzeichnis:
1. Die Bewertung des neuen IDW S 16
2. Der Umfang des neuen IDW S 16
3. Krisenfrüherkennung im IDW S16
4. Ab wann sich ein Unternehmen in einer Krise befindet
5. Auf welche Krisenanzeichen sollten Unternehmen achten?
6. Was im Krisenfall passieren sollte
7. Wann eine StaRUG-Restrukturierung möglich und sinnvoll ist
Herr Koch, wie bewerten Sie den neuen IDW S 16?
Koch: In §1 des StaRUG ist für alle Geschäftsleiter haftungsbeschränkter Unternehmen eine Pflicht zur Krisenfrüherkennung und zum Krisenmanagement normiert. Dass das IDW im November 2025 die finale Fassung des neuen IDW Standards IDW S 16 veröffentlicht und darin auch die Anforderungen an die Ausgestaltung der Krisenfrüherkennung und des Krisenmanagements konkretisiert hat, halte ich für einen ersten wichtigen Schritt in die richtige Richtung – gerade auch, weil ein konkreter Leitfaden für die unternehmerische Praxis immer wichtiger wird.
Welche Punkte umfasst der neue IDW Standard?
Koch: Kernstück und Fundament der Krisenfrüherkennung ist eine integrierte Unternehmensplanung. Die Anforderungen des § 1 StaRUG an die Krisenfrüherkennung werden konkretisiert, da der Standard die Implementierung eines effektiven Krisenfrüherkennungssystems als Grundlage für das folgende Krisenmanagement durch die Geschäftsleiter vorsieht.
Was bedeutet das konkret?
Koch: Nach IDW S 16 umfasst der Prozess der Krisenfrüherkennung die Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen und Maßnahmen zur frühzeitigen Identifizierung bestandsgefährdender Risiken und ist ein fortlaufender Kreislauf, der sich ständig weiterentwickelt. Dazu gehören im Rahmen einer fortlaufenden Unternehmensplanung die Risikoidentifikation, Risikobewertung, Risikosteuerung, Risikokommunikation und letztlich die Risikoüberwachung. Damit die Überwachung von fortbestandsgefährdenden Entwicklungen fortlaufend erfolgen kann, sind im Unternehmen geeignete organisatorische Vorkehrungen zu treffen. Ziel des fortlaufenden Prozesses ist es, die Geschäftsleitung bestmöglich zu unterstützen ihre Pflichten nach § 1 StaRUG zu erfüllen.
Ab wann befindet sich ein Unternehmen denn in einer Krise?
Koch: Ein Unternehmen befindet sich in einer Krise, sobald seine wirtschaftliche Stabilität oder Fortbestehensfähigkeit ernsthaft gefährdet ist. Diese Gefährdung kann finanzieller, strategischer, operativer oder reputationsbezogener Natur sein und wird typischerweise durch mehrere aufeinanderfolgende Krisenphasen deutlich. Das IDW unterscheidet sechs typische Stadien, die den Verlauf einer Unternehmenskrise kennzeichnen: Stakeholder-, Strategie-, Produkt-/Absatz-, Erfolgs-, Liquiditätskrise und schließlich die Insolvenzreife. Ein Unternehmen befindet sich in der Krise, sobald die Fortführung des Geschäftsbetriebs ohne Gegenmaßnahmen gefährdet ist. Rechtlich bedeutsam wird dies ab Eintritt der Liquiditätskrise, da ab diesem Zeitpunkt Insolvenzantragspflichten entstehen können.
Die beste Krise ist ja die, die niemals eintritt. Auf welche Krisenanzeichen sollten Unternehmen achten?
Was sollte passieren, wenn Geschäftsleiter ein oder mehrere Krisenanzeichen erkennen?
Koch: Grundsätzlich gilt: Geschäftsleiter sollten eine notwendige Restrukturierung oder Sanierung rechtzeitig angehen, wenn ihr Unternehmen noch Reserven hat. Wenn Gegenmaßnahmen frühzeitig eingeleitet werden, bestehen bessere Chancen auf eine erfolgreiche und nachhaltige Restrukturierung. Bei finanziellen Schwierigkeiten ist zunächst immer der Versuch einer außergerichtlichen Sanierung sinnvoll. Dies erfordert jedoch oft schwierige Verhandlungen mit den Gläubigern, die dem Sanierungskonzept zustimmen müssen, wenn ihnen Sanierungsbeiträge abverlangt werden sollen. Stimmt auch nur ein Gläubiger nicht zu, kann es unmöglich werden, auf diesem Weg eine Lösung zu finden. Bei einem StaRUG-Verfahren müssen dagegen nur drei Viertel der betroffenen Gläubiger dem Restrukturierungsplan zustimmen und das Unternehmen kann sich mit einem angepassten Finanzplan außerhalb eines Insolvenzverfahrens und unter Ausschluss der Öffentlichkeit neu ausrichten.
Eine Restrukturierung mit Hilfe des StaRUG ist nicht für alle Fälle geeignet
Koch: Das stimmt. Bei Unternehmen, die weitergehende operative oder strategische Herausforderungen zu bewältigen haben, sind außergerichtlich nicht zu bewältigen sind, weil zum Beispiel größere Personalmaßnahmen nötig sind, ist einem Regelinsolvenzverfahren, eine Eigenverwaltung oder einem Schutzschirmverfahren oft die einzige Option. Das StaRUG ist in erster Linie für Fälle gedacht, in denen das Unternehmen im einem mittleren Krisenstadium vorrangig finanzielle Probleme lösen muss. So lassen sich in einer StaRUG-Restrukturierung – im Gegensatz zu einer Sanierung in Regelinsolvenz, Eigenverwaltung oder Schutzschirm – keine ungünstigen Verträge gegen den Willen der Vertragspartner kurzfristig beenden und insbesondere, es gibt kein Insolvenzgeld und es gelten die insolvenzspezifischen Erleichterungen im Arbeitsrecht wie verkürzte Kündigungsfristen nicht.
Wann ist ein StaRUG-Verfahren nicht möglich?
Koch: Wenn das Unternehmen seine Zahlungsfähigkeit absehbar nicht mehr sicherstellen kann. Mit dem Schutzschirmverfahren, der Eigenverwaltung, aber auch mit der Regelinsolvenz stehen in einem solchen Fall aber weitere gerichtliche Sanierungsverfahren zur Verfügung. Auch das Schutzschirmverfahren kann ein Unternehmen allerdings nur beantragen, wenn die Zahlungsunfähigkeit nur droht, sie aber noch nicht eingetreten ist.
Und wenn es bei einem Geschäftspartner eine Krise oder sogar eine Insolvenz gibt?
Koch: Grundsätzlich ist es für Unternehmen immer wichtiger, sich auf die mögliche Krise oder Insolvenz eines Geschäftspartners vorzubereiten. Eine Option mit großer Wirksamkeit sind sogenannte insolvenzabhängige Lösungsklauseln. Dabei sind jedoch einige Besonderheiten zu beachten.
Interviewpartner:
Guido Koch ist Dipl.-Kaufmann, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei Schultze & Braun. Zu seinen Spezialgebieten gehören neben den unterschiedlichen Themenaspekten aus der betriebswirtschaftlichen Restrukturierung und der Wirtschaftsprüfung auch die Beratung in Eigenverwaltungen und Schutzschirmverfahren.